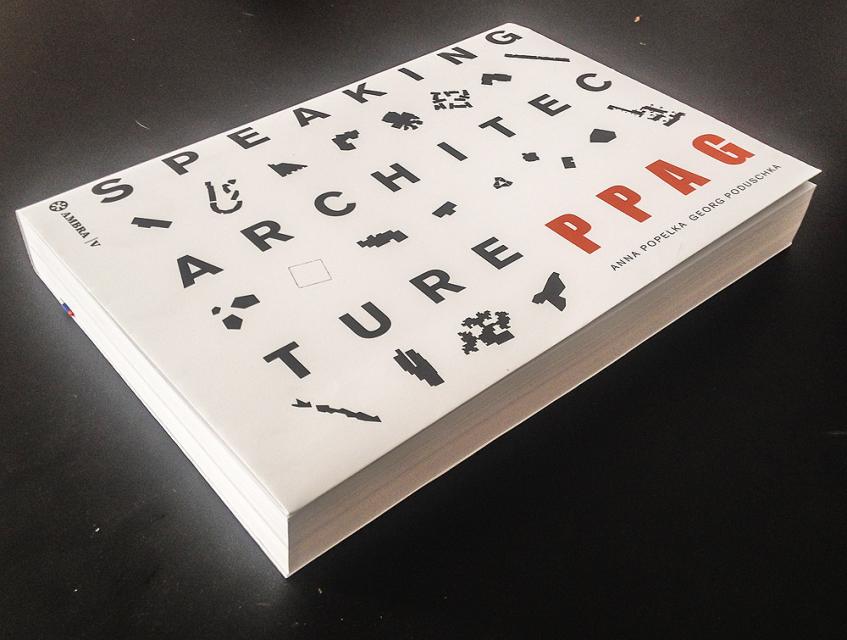Muss Architektur politisch korrekt sein, oder ist sie per se politisch zahnlos? Über die Moral des Bauens, zwischen Stars und Favelas.
"Die wollen sich doch nur bereichern!" Es ist eine immer wieder erstaunliche Tatsache, dass kaum eine Berufsgruppe diesen stereotypen Vorwurf so oft zu hören bekommt wie die Architekten. Selten hört man, dass Klempnern, Friseuren, Unfallchirurginnen oder Taxifahrerinnen hämisch nachgesagt wird, sie würden das, was sie tun, nur des Geldes wegen tun. Selbst den in Boni badenden Bankern wird ihr schwindelerregender Reichtum bei mancher Mißgunst noch nachgesehen, wohl weil der Laie nicht zugeben will, dass er nicht ganz versteht, was die Bonibanker eigentlich tun. Bei den Architekten glaubt er dies sehr wohl zu wissen, und paart den Bereicherungsvorwurf gerne mit dem der "Selbstverwirklichung", offenbar etwas furchtbar Verwerfliches.
Entweder Dienstleister mit Bezahlung oder Künstler, dann aber bitte umsonst? Die wenigen vielbezahlten Künstlerarchitekten kamen bisher dank Glam-Faktors meist glimpflich davon. Nicht mehr, wie der Fall Zaha Hadid zeigt. Die Fragen nach den Zuständen im Umfeld des Bauens, von den Baustellen in Katar über Land-Grabbing in Afrika und Zerstörung von Stadtstrukturen in China werden lauter. Nein, die Stars sind hier nicht schuldiger als die anderen, doch wenn gerade sie beteuern, man sei eh das schwächste Zahnradl in der Maschine und man könne ja leider, leider eh nicht, selbst wenn man wollte, klingt das etwas schief.